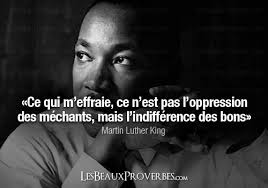David Nussbaumer ist vor kurzem zum Täuferischen Forum für Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfung gestossen. Er bringt eine Internationale Perspektive mit, da er Mitglied ist in der Arbeitsgruppe der Mennonitischen Weltkonferenz (MWK) für die Bewahrung der Schöpfung. Wir haben David gebeten, sich kurz vorzustellen und etwas über sein Engagement und seine Herausforderungen zu sagen.
Kannst du dich in wenigen Worten vorstellen?
Ich bin französisch-schweizerisch, verheiratet und habe drei Kinder. Ich lebe mit meiner Familie im Südelsass und besuche die Mennonitenkirche in Altkirch. Ich habe Wasser- und Umweltingenieurwesen mit Schwerpunkt Wasser und Sanitärversorgung in Kontexten der humanitären Entwicklung und Nothilfe in England und Sambia studiert. Danach arbeiteten meine Frau Aline und ich sieben Jahre lang für die Organisation A Rocha France in der Domaine des Courmettes, einem Zentrum zur Erforschung der Biodiversität und zur Umwelterziehung. Außerdem haben wir am Regent College (Vancouver) Theologie studiert, mit einem starken Interesse an sozialer und ökologischer Gerechtigkeit. Als leidenschaftlicher Naturalist verbringe ich viel Zeit damit, nicht-menschliche Kreaturen (Vögel, Schmetterlinge, Reptilien, Orchideen usw.) zu beobachten und zu identifizieren. Seit 2022 bin ich der Europa-Vertreter in der Arbeitsgruppe für den Schutz der Schöpfung der Mennonitischen Weltkonferenz und in dieser Funktion trete ich nun dem Täuferischen Forum für Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfung bei.
Welche Perspektiven siehst du im Zusammenhang mit der Klima- und Biodiversitätskrise?
Wenn man sich sieht, was in der Welt passiert, sind die Aussichten nicht gut. Ich denke jedoch, dass wir in Jesus Christus sowohl eine Hoffnung haben, die uns nicht alarmiert oder entmutigt, als auch ein Beispiel, das uns zum Handeln anregt. Ich möchte hier einige meiner derzeitigen Überlegungen mitteilen:
Erstens scheint es mir notwendig, dass wir unseren Blick auf die nicht-menschliche Schöpfung ändern. Die natürliche Welt existiert nicht für die Menschen. Sie ist nicht in erster Linie eine Ansammlung von Ressourcen, die es uns ermöglichen, uns auf Kosten anderer Kreaturen zu entwickeln. Eine biblische Perspektive weist uns darauf hin, dass die Welt für Jesus Christus geschaffen wurde und Gott gehört. Wir sind gemeinsam mit den anderen Lebewesen Mitgeschöpfe, die geschaffen wurden, um Gott zu loben. Wir haben zwar einen besonderen Status und eine besondere Rolle, aber diese liegen dennoch eher in der Verantwortung, sich um die anderen Geschöpfe zu kümmern, nach dem Vorbild Gottes, der sich um seine gesamte Schöpfung kümmert.
Zweitens: Der Gott der Bibel verteidigt die Schwachen, „die Witwe und die Waisen“. In der aktuellen politischen Lage auf anderen Kontinenten, aber auch bei uns, steigt die Popularität starker (Männer), die ihre Macht missbrauchen, um das zu bekommen, was sie wollen. Was für ein schönes Zeugnis ist es, heute in der Nachfolge Jesu für arme und unterdrückte Menschen einzutreten und sich für ihre Rechte einzusetzen. Ich schlage vor, diesem die Verteidigung der vom Aussterben bedrohten nichtmenschlichen Arten und der ausgebeuteten Naturräume hinzuzufügen, wenn auch vielleicht in geringerem Maße, auch als Einsatz für den Schalom der Herrschaft Gottes.
Drittens halte ich es für notwendig, dass die reichsten Bevölkerungsgruppen den ökologischen Wandel, die Anpassung an den Klimawandel und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt für die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen finanzieren. Das wäre keine Wohltätigkeit, sondern ein Akt der Gerechtigkeit. Wie die COP29 in Baku gezeigt hat, ist dies ein sehr sensibles Thema, da die westlichen Regierungen nur ungern das Wirtschaftswachstum ihrer Nationen einschränken. Wird ein reiches Land den Mut haben, auf einen Teil seines Komforts zu verzichten, um das zu tun, was gerecht ist? In einem viel kleineren Maßstab wird die Mennonitische Weltkonferenz demnächst Zuschüsse für Mitgliedskirchen in Afrika, Asien oder Lateinamerika anbieten, die ein Projekt zur Bewahrung der Schöpfung aufbauen wollen.
Was sind deine Dilemmas und Fragestellungen im Moment?
Eine sehr große Frage! Manchmal habe ich den Eindruck, dass mein Leben ein ständiges Dilemma ist: Der CO2-Fußabdruck, als französischer Staatsbürger in Frankreich zu leben und alle öffentlichen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, scheint für das Klima bereits zu hoch zu sein. Ich gehöre zu den Bevölkerungsgruppen, die dafür sorgen, dass wir derzeit sechs der neun planetaren Grenzwerte überschreiten, die vom Stockholm Resilience Centre untersucht wurden. Sollte ich deshalb aus diesem Kontext aussteigen, mit den sozialen und familiären Folgen, die das hätte? Und was würde sich dadurch ändern? Sollte man sich nicht vielmehr daran beteiligen, das „System“ von innen heraus weiterzuentwickeln? Während ich dort handle, wo ich kann (oder zumindest bereit bin, es zu tun!), nähren die Praktiken des Klagens und der Buße meinen Dialog mit Gott über meinen Konsum und meinen Fußabdruck auf diesem Planeten.
Zweitens stelle ich mit Traurigkeit eine Zunahme des Gegensatzes zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz fest, zumindest in Frankreich (ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch so ist?). Umweltstandards werden beschuldigt, die Hauptlast der Landwirte zu sein. Ich frage mich jedoch, ob das Problem nicht eher in der viel zu niedrigen Vergütung im Vergleich zu dem Dienst, den die Landwirte für die Gesellschaft leisten, liegt. Ist die Last der Landwirtschaft nicht vielmehr das Agrobusiness? Wenn man die niedrigen Preise einiger Supermarktketten und die von ihnen ausgewiesenen Gewinnspannen sieht, drängt sich diese Frage auf. Werden die Verbraucher bereit sein, mehr zu zahlen, wenn sie ihre Lebensmittel verstärkt über kurze Wege beziehen?
Schließlich frage ich mich auch, wie man am besten über die Klima- und Biodiversitätskrise sprechen kann. Wenn man viel Zeit damit verbringt, Zahlen und Fakten zu teilen (z. B. Bilder von den Bränden in Los Angeles oder den Überschwemmungen in Valencia), besteht die Gefahr, dass man Entmutigung, Angst oder Verleugnung auslöst. Wenn umgekehrt nur die Schönheit der Natur hervorgehoben wird, besteht die Gefahr, dass das Ausmaß der Krise heruntergespielt wird. Es ist nicht leicht, das Gleichgewicht zu finden, und eindeutig tendiert meine Natürlichkeit zu der ersten Option. Ein Weg, den ich kürzlich entdeckt habe und den ich erforschen möchte, ist, die meiste Zeit damit zu verbringen, über Lösungen oder Handlungsmöglichkeiten zu sprechen. Ich denke also darüber nach, wie ich das in meinen nächsten Beiträgen oder Diskussionen besser einbauen kann: mit einer klaren, aber kurzen Feststellung beginnen, dann Beispiele dafür erkunden, was andere tun, und schließlich konkrete und realistische Maßnahmen auflisten, wobei ich in Bezug auf die Grenzen ehrlich bin. Ich hoffe, dass dies ein begeistertes Engagement hervorruft!